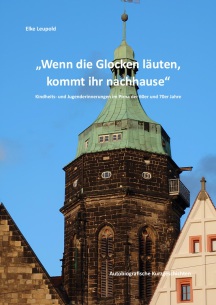Wenn die Glocken läuten, kommt ihr nachhause
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ein kleines Stück Heimatgeschichte aus der Sicht des Kindes in den 60er und 70er Jahren zum Schmunzeln, Erinnern und Nachdenken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jetzt erhältlich auf www.amazon.de und im Shop von www.epub.de
ISBN: 978-3-565-0285
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Kaffeekränzchen“
Warum muss man als Kind eigentlich zu jeder bekannten Frau der Oma Tante sagen? Für die Klärung dieser Frage bleibt wieder einmal keine Zeit, denn die Oma kocht in der Küche Kaffee und erwartet ihre Freundinnen. Für uns heißt das, schnell verstecken. Doch jedes noch so gute Versteck hilft nicht, die finden einen immer. Dann wird man in die Wangen gekniffen, festgestellt, dass man groß geworden ist und auf einen Stuhl gesetzt- ob man will oder nicht. Es klingelt. Die Oma ist noch beim Kaffeekochen also muss ich die Tür öffnen. Tante Hilde, Tante Elfriede und Tante Liesel stehen vor der Tür. Da fehlt doch noch eine? Dauert nicht lange und Tante Trudel trudelt ein. Das Kaffeekränzchen ist vollständig. Wir verstehen den Inhalt ihrer Gespräche nicht. Es klingt alles wie eine Gruselgeschichte aus längst vergangenen Zeiten und dann passiert immer etwas Merkwürdiges. Gerade wenn es für uns Mädchen spannend wird, brechen sie plötzlich das Gespräch ab und eine der Tanten wirft ein neues Thema auf. Manchmal wird auch noch eine Tasse Kaffee verlangt und diese Unterbrechung geschickt zum Themawechsel genutzt. Wir Mädchen mögen die Tante Liesel. Die kleine rundlich wirkende Frau beginnt aber wirklich jeden ihrer Sätze mit : “Nu ich will e ma sagen…“ Bei einem der Kaffeekränzchen erzählt sie begeistert, dass sie bald zu ihren Kindern ziehen kann, in den Westen und wie gut sie es dann dort hätte. Muss ein toller Ort sein, dieser Westen. Da will ich auch mal hin. Wenn ich doch nur wüsste, wo und vor allem was dieser Westen eigentlich ist.
„Wenn der Eismann klingelt“
Mit seinem kleinen LKW fährt er vor, hält, steigt aus und öffnet die hintere Ladeklappe. Dann greift er nach der Glocke und bimmelt laut drauflos. Alle Spielgefährten der Straße sind schon versammelt und warten auf das Schauspiel. Ich höre die Mutti rufen, ich solle mal für einen Groschen Eis holen. So renne ich die paar Stufen nach oben, erhalte einen Groschen und den alten Scheuerhader. In letzteren soll der Eisblock eingewickelt werden. Dann zurück zum Auto und dem Eismann die Bestellung aufgegeben. „Für einen Groschen Eis bitte.“ Der Eismann trägt große tiefdunkelblaue Gummihandschuhe und hält in einer Hand einen Eispickel, mit dem er einen der Eisblöcke zu sich heranzieht. Dann zerteilt er diesen, packt mir ein Stück davon auf meinen Scheuerhader und obwohl ich das Tuch auf den Händen habe, wird es sofort sehr kalt. Dieser Umstand veranlasst mich so schnell wie nur möglich wieder in unsere Küche zu gelangen. Die Mutti öffnet die obere Tür des Eisschranks und ich packe den Block da hinein. Eines verwundert mich allerdings immer wieder, woher weiß der Eismann wie groß unser Kühlschrank ist, denn der Eisblock passt jedes Mal ganz genau in das für ihn vorgesehene Fach hinein. Seltsam.
„Hausaufgabenzeit“
Unseren Klassenlehrer Herrn Z. mögen wir alle sehr. Seine Beliebtheit gerät allerdings bei den ständigen Hausaufgaben ein wenig ins Wanken. Heute sollen wir daheim mehrmals das Wort „Eimer“ in unser kleines liniertes Heft schreiben. Drei Zeilen „Eimer“ und das, wo ich doch so meine Schwierigkeiten mit dem Schreiben habe. Am Abend kommt der Vati von der Arbeit und will meine Hausaufgaben sehen. Im festen Glauben es sei alles richtig lege ich mein Heft vor. Seine Miene verfinstert sich und ich komme einmal mehr in den Genuss seiner Autorität. Da nimmt man automatisch Haltung an. Er sagt, dass der „Eimer“ falsch geschrieben sei. Bei näherer Betrachtung lese ich selbst das Wort „Eimre“. Füller holen, hinsetzen, noch einmal von vorn. Jetzt ist es aber wirklich richtig. Vati lässt den „Emre“ nicht gelten. Noch einmal. Die Mutti mischt sich in Vatis militärischen Erziehungsstil ein und sagt, ich solle es doch einfach so schreiben wie ich es höre. Gern doch, das ist doch mal eine Lösung für das Problem. Wie ich schnell feststellen werde, ist unser sächsischer Dialekt dabei kein guter Berater. Am Ende steht da der „Emer“ und hält mit dieser Schreibweise als niedliche Anekdote seinen Einzug in die Familiengeschichte.